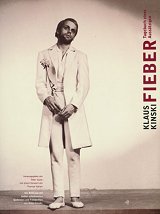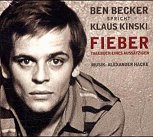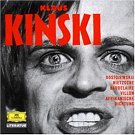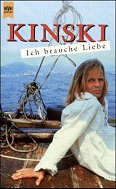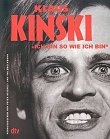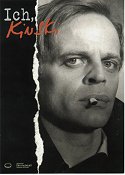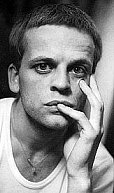
Klaus Kinski- 1954
(Foto: Hanns-Joachim Starczewski / Deutsches Filmmuseum Frankfurt a.M.) Filmuseum Potsdam |
Klaus Kinski: Ein deutsches Grauen? Klaus Kinski, geboren am 18. Oktober 1926 als
Nikolaus Günther Karl Naksynski in Zoppot/Danzig, gestorben am 23. November 1991 in
Lagunitas/San Francisco, wäre im vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden; gleichzeitig
jährte sich sein Todestag zum zehnten Mal.
Beide Anlässe fanden im Medium Fernsehen, das zu solchen Anlässen normalerweise mit
unzähligen Filmwiederholungen aufwartet, kaum ein Echo. Offenbar mag man lieber
handzahmeren Filmschaffenden huldigen. Polarisiert und erhitzt Klaus Kinski womöglich bis
über den Tod hinaus die Gemüter? "Der Mann, den alle zu hassen liebten, wenn auch
aus ganz unterschiedlichen Motiven, [...] war nicht durch seine Filme, sondern trotz der
Filme, mittendrin und außerhalb, eine eigene Geschichte. Es ist die Geschichte einer
exaltierten Passion: ein deutsches Grauen, das zu sich kommt, indem es anderes zerstörend
sich selbst zerstört", heißt es in einem Nachruf (Georg Seeßlen, Klaus Kinski -
Ein deutsches Grauen, Epd Film 1/1992.). |
| Kinskis Geschichte und seine zerrissene Persönlichkeit interessieren auch
heute noch, aber man kann und muss sie unter weit mehr Aspekten sehen. Und deshalb vollzog
sich die Hommage an einen der exzentrischsten und international bekanntesten deutschen
Schauspieler folgerichtig auf ganz anderer Ebene, nämlich im Rahmen retrospektiver
Ausstellungen und diverser Publikationen von Büchern wie CDs. Verwiesen werden soll an
dieser Stelle auf eine ambitionierte Kinski-Fansite: http://www.klaus-kinski.de/,
die zum Stöbern einlädt und kaum eine Frage offen lässt. Nachfolgend eine kleine
Auswahl aus den Veröffentlichungen des Kinski-Jubiläumsjahres 2001.

|
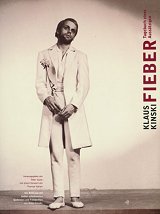
Klaus Kinski, „Fieber" - Gedichtband
|
Ich weiß nicht, wer ich bin und wer ich war
Ein Fremder vor mir selbst und neu für mich
Und alt, wenn ich im Spiegel sehe
Ich glaubte, dass ich überall zu Hause sei
Und war schon heimatlos, bevor ich noch ganz dort war
Ich bin durchaus sehr zart und fühl‘ mich doch kräftiger als alle
So stark manchmal, so schwach so oft [...] |
| Herausgeber Peter Geyer stieß 1999 zufällig bei einer Nachlassauktion
auf den jahrzehntelang verschollenen maschinengeschriebenen Gedichtband, von dessen
Existenz kaum jemand wusste und dessen Authenzität nicht unumstritten ist. Thomas Harlan,
der mit Klaus im Frühjahr 1953 in Paris ein Hotelzimmer teilte, erinnert sich, wie die
Gedichte entstanden. Kinski habe wie ein Besessener geschrieben, dem Freund vorgelesen, ja
gebrüllt, und alles, so mutmaßt Harlan heute, aus Liebe zu einer schwerkranken jungen
Norwegerin namens Bergell, die damals für kurze Zeit Kinskis Geliebte gewesen sei. Ein
unstetes, unruhiges Leben führten die beiden, „alles war wie Fieber damals".
Die gebundenen Manuskripte Kinskis ließen sie zusammen mit überflüssigem Reisegepäck
bei einem Freund zurück - und holten es nie ab. |
| So manche männlichen deutschen Schauspieler sehen sich in
Kinski’scher Tradition. Besonders diejenigen, die sich gern selbst inszenieren. Wenn
sie allerdings Ben Becker heißen, mit volltönender Stimme gesegnet sind und aus Kinskis
lyrischen Ergüssen eine regelrechte Performance zu veranstalten wissen - dann sei ihnen
verziehen. Ein Auswahl von 12 Stücken findet sich auf der CD. Becker bringt die
wahnwitzigen Texte, diesen „lyrischen Auswurf voll Weltschmerz, Weltwut und wahrer
Körperflüssigkeitenflut" (taz vom 19.12.2001) mal vehement, mal zurückgenommen,
immer suggestiv zu Gehör. Herausragend die akustisch-musikalische Untermalung Alexander
Hackes („Einstürzende Neubauten"), u.a. mit Alltagsgeräuschen, die eine
atmosphärische Note hinein bringt. Selbst obszöne, Ekel erregende Passagen gewinnen eine
seltsame, vorher ungeahnte Faszination, die aber nur schwer auszuhalten ist. |
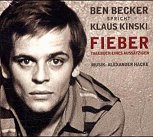
Klaus Kinski, „Fieber". Tagebuch eines
Aussätzigen, hg. von Peter Geyer, mit einem Vorwort von Thomas Harlan, Eichborn 2001.Fieber. Ben Becker spricht Klaus Kinski,
Musik von Alexander Hacke, BMG 2001, ca. 46 min. |
|
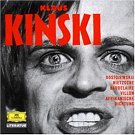
Klaus Kinski.
Deutsche Grammophon Literatur 2001
CD ca. 70 min. |
"Kinski spricht ..." - Unter diesem knappen wie präzisen Titel
ging der einst hochgelobte Theaterdarsteller, der sich in kein Schauspielensemble
dauerhaft integrieren ließ oder lassen wollte, seit den späten 1950er Jahren als Solist
auf Tournee und nahm zahlreiche Schallplatten auf, die sich ausnehmend gut verkauften.
(Vielleicht weil gelegentlich hüstelnde Hörer auf dem heimischen Sofa nicht Gefahr
liefen, von einem erzürnten Rezitator beschimpft zu werden?) Herausragendes Merkmal
seiner charismatischen Vortragskunst: die Lautstärke. Kinski schreit Klassisches
(Schiller, Shakespeare u. a.), Exzentrisches (Villon, Rimbaud), auch mal Exotisches
("Dichtung afrikanischer Völker"). |
| Eigenmächtige Abänderungen literarischer Texte, "an
denen der Orator so lange herumfeilt, bis sie sich in Dumdum-Geschosse verwandelt
haben" ("Spiegel" 9/1961), waren nicht selten. Vom Publikum wird Kinski
stürmisch gefeiert, wie z.B. 1957 mit Villon-Gedichten in Wien, vom Feuilleton hingegen
werden beide geschmäht: "Wer aber ist dies offenbar doch unmündige Publikum? Es
sind dieselben Leute, Akademiker, Bibliothekarinnen, Angestellte, Studenten, junge Damen
und alte Mädchen, die sich bei Premieren absurden Theaters als die Claqueure jeglichen
Avantgardismus gebärden. [...] Die Hände gefaltet und schwach lächelnd, nimmt er die
Huldigung der Hunderte entgegen, die sich um den Meister scharen wie um einen
Religionsstifter. [...] Die Gefühle, die er in der ,Masse' hervorruft und ihr zugleich
abnimmt, stammen aus jenen gefährlichen Bereichen des Bewußtseins, die die großen
Rattenfänger des Jahrhunderts zu nutzen verstanden und verstehen werden." (FR vom
8.2.1960, zit. nach P. Reichelt, Der Deklamator, in: Ich bin so, wie ich bin, S. 96f.) Erstmals
legt die Deutsche Grammophon nun Aufnahmen aus dem Jahr 1960 auf CD vor: Auszüge aus
Dostojewskijs "Schuld und Sühne" und Baudelaires "Die Blumen des
Bösen", afrikanische Lyrik, Gedichte von Friedrich Nietzsche sowie "Balladen
und lasterhafte Lieder" von François Villon. Was auf den ersten Blick als gewagte
Mischung literarischer Texte anmutet, erweist sich als kleiner Querschnitt durch Kinskis
Lesungen. Gewöhnungsbedürftig für heutige Ohren ist der antiquierte Rezitationsstil,
den Kinski pflegte und der schon damals überhaupt nicht mehr der seit Beginn der 1960er
Jahre auf deutschen Bühnen Einzug haltenden "neuen Sachlichkeit" entsprach. Ein
häufiges Übermaß an Pathos, ,"schnarrendes R", ein oft in die Monotonie
abgleitender Sprachductus machen das erstmalige Abspielen der kompletten CD nicht
unbedingt zu einem akustischen Highlight und lenken von den Inhalten zunächst ab. Erst
das mehrmalige Anhören und ,Sich-einlassen', vor allem auf die Villon- und
Baudelaire-Stücke, offenbaren Kinski Einfühlungsvermögen bei der Interpretation. HIER
geht es zu einer Rezension im Hoerbuecher4um zu "Kinski spricht
Schiller" aus der Reihe "Kinski spricht" |
|
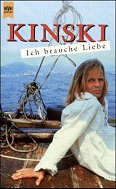 |
Klaus Kinski, Ich brauche Liebe, Heyne Tb
(ursprünglich für den amerikanischen Buchmarkt ergänzte Fassung von "Ich bin so
wild nach Deinem Erdbeermund"). Kinski braucht Liebe. Wer
braucht die nicht? Die Frage ist nur: Wer braucht diese Autobiographie? Niemand.
Klatschspalten-Klaus erfindet sich eine proletarische Kindheit und beschreibt
hingebungsvoll seine vielfältigen sexuellen Ausschweifungen. Ob das alles wirklich so und
nicht anders passiert ist? Da zweifelte sogar der Verleger - jedenfalls ist es den
Beteiligten nicht zu wünschen. (Gut, dass manche von ihnen schon lange tot sind.) So
landet man als Serie in "Bild", aber nicht in Bücherregalen. |
|
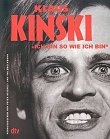
Ina Brockmann u. Peters Reichelt,
Ich bin so, wie ich bin,
dtv 1. Auflage 2001. |
Ina Brockmanns und Peters Reichelts in vier thematische Abschnitte gegliederte
Anthologie lenkt den Blick hauptsächlich auf das künstlerische Schaffen Kinskis. Die
Aufsätze verschiedener AutorInnen zeichnen ein Bild des Schauspielers, das sich von den
stereotypen Klassifizierungen des "wahnsinnigen Genies" oder "Irren vom
Dienst" wohltuend abhebt (skandalträchtige Enthüllungen werden sensationslüsterne
LeserInnen darin vergeblich suchen) und das dennoch nicht ‚weich gespült‘
wirkt. Hinzu kommen persönliche Anmerkungen ehemaliger Kollegen, wie z. B. Helmut
Qualtinger, die sich ihrer Zusammenarbeit mit Kinski erinnern. |
| Klaus Kinski und die Bühne: Claudia Balk skizziert
Kinskis erste Schritte auf renommierten deutschsprachigen Theaterbühnen, darunter dem
Wiener Burgtheater, während sich Peter Reichelt dem Wirken Kinskis als Rezitator widmet
ebenso wie der Nachdruck des "Spiegel"-Titels 9/1961 ("Deklamator
Kinski"). Klaus Kinski und der Film: Georg Seeßlen verfolgt Kinskis Erfolge
wie Misserfolge von Wallace über den Italo-Western bis Herzog. Über das letzte
ambitionierte "Paganini"-Projekt berichtet Carsten Frank.
Biographische Informationen gibt schließlich Ina Reichelt anhand einer
chronologisch-tabellarischen Übersicht. Ein Werkverzeichnis rundet den Band ab.
Nicht zuletzt besticht der Begleitband zu der ebenfalls von Reichelt und Brockmann
konzipierten gleichnamigen Wanderausstellung, die noch bis Herbst 2003 gezeigt wird, durch die Wahl seiner
Abbildungen, darunter Filmstandfotos und Plattencover wie Privatfotos. Die kontrastreiche
und spannungsgeladene Anordnung des zum Teil bisher unveröffentlichten Bildmaterials
macht das Stöbern zum Vergnügen. |
|
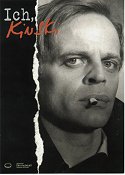
Klaus Kinski
(Foto: Coverfoto des Katalogs zur Ausstellung. Der Katalog kann für 23,- € hier bestellt werden - ISBN
3-88799-063-3) |
"Ich, Kinski." Ausstellung des Deutschen Filmmuseums Frankfurt
am Main, derzeit zu sehen im Filmuseum Postdam.
Die Ausstellung "Ich, Kinski" gibt einen Gesamtüberblick über Leben und
Arbeiten Klaus Kinskis. Sie zeichnet seine Anfänge als Theaterschauspieler in englischer
Kriegsgefangenschaft sowie seinen ersten Theaterskandal mit Cocteaus "La voix
humaine" (Berlin 1949) nach und widmet sich ausgiebig seinen Rezitations-Auftritten
und Schallplattenaufnahmen. Das filmisches Werk zwischen 1947 bis 1989 ist mit Fotos,
Originalfilmrequisiten (wirklich zum Fürchten: das "Nosferatu"-Kostüm) und
Filmausschnitten vollständig vertreten, von den frühen Filmen über die schon fast
‚legendären‘ Edgar Wallace-Verfilmungen, bei denen wir uns doch alle so schön
vor Klaus gegruselt haben, hin zu den seichten bis peinlichen B-Pictures und
Spaghetti-Western, um bei Werner Herzog ausgiebig Station zu machen und schließlich bei
Kinskis letztem engagierten Projekt zu enden: "Kinski-Paganini".
Anmerkung: Vom 09.04.-09.06.2003 ist die Aussellung "Ich,
Kinski" im Österreichischen Theatermuseum in Wien zu sehen. |
| Biographische Notizen ergänzen die thematischen
Schwerpunkte, so dass den Schauspieler von einer persönlichen Seite kennen lernt, u.a.
als Sohn gutbürgerlicher Herkunft (was er selbst immer bestritt) oder als Vater, der
Steifftiere sammelte und seinem Sohn zärtliche Briefe schrieb. Zum ausgiebigen
Stöbern, Zuhören und -schauen laden die zahlreichen Zeitungsartikel, Faksimiles,
Rezitationsaufnahmen sowie Film- und Interviewausschnitte ein. Man sollte sich deshalb
Zeit nehmen, um diese Ausstellung zu entdecken. Und wer den Hörer des alten schwarzen
Telefons abheben mag, kann vor der "Edgar-Wallace"-Wand sogar mit Klaus
telefonieren.
Der Katalog zur Ausstellung ist leider nur vor Ort beziehbar, nicht im Buchhandel. An
den jeweiligen Ausstellungorten wird meist ein umfassendes cineastisches Begleitprogramm
angeboten.
Kleiner Tipp: Unbedingt im Gästebuch blättern - Liebeserklärungen von Fans sind
manchmal skurriler als ihr Idol...

|
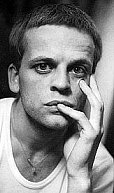
![]()